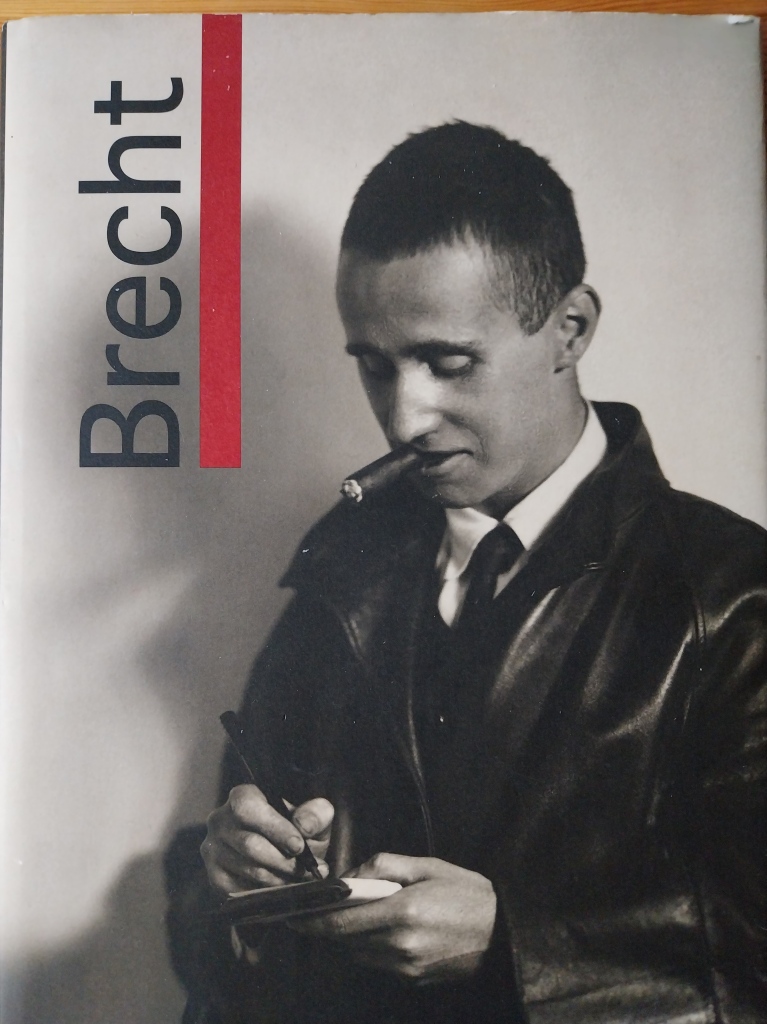Bis heute hat der aus dem lauschig-engen Calw stammende Dichter Hermann Hesse (1877 – 1962) ein großes Leserpublikum in Deutschland und der Welt. Er wurde und wird darüber hinaus als unangepasste Persönlichkeit, als Pazifist und Gegner des Naziregimes geschätzt. Nicht zuletzt links und rechts der Donau.
Die Stadt Ulm zählt inzwischen um die 120.000 Einwohner. Mit der bayerischen Nachbarstadt Neu-Ulm sind es nahezu 180.000. Viele Menschen lieben diese Städte, leben gerne hier, kommen als Touristen oder finden einen attraktiven Arbeitsplatz und bleiben auf Dauer.
Dass Hermann Hesse eine ganz besondere Beziehung zu Ulm (und zu Neu-Ulm) hatte, entdeckten die beiden Bibliothekare Jan Haag und Bernd Michael Köhler. Als sie der Sache intensiver nachgingen stießen sie auf bibliographische und archivarische Quellen die belegen, dass dieses Verhältnis Hesses zu Ulm, Neu-Ulm (und Blaubeuren!), zu Freunden und Bekannten in der Region, sehr viel weitreichender und vielfältiger war als es die bisher bekannten biographischen Publikationen wiedergeben. Ihre Recherche-Ergebnisse und die daraus resultierenden Erkenntnisse haben sie in einem kleinen Buch zusammengefasst.
“Seien Sie gegrüßt, liebe Freunde in Ulm. Hermann Hesse und die schwäbische Donaustadt”, stieß auf breites Interesse in Ulm und Umgebung, sowie darüber hinaus bei vielen die sich für diesen Schriftsteller und regionale Bezüge in der deutschen Literaturgeschichte interessieren. Die neuen Quellen, die die beiden Autoren entdeckten und auswerten konnten, fanden große Beachtung in der einschlägigen Hesseforschung. Der ausführliche bibliographische Anhang des Buches dokumentiert die gesamten ausgewerteten Quellen. Ein kleines, feines Weihnachtsgeschenk oder eine originelle Aufmerksamkeit zwischendurch für Literatur- oder Ulmfreunde.
Kaufen Sie auf jeden Fall vor Ort in ihren lokalen Buchhandlungen. Bei den meisten können Sie das auch bequem online erledigen. Die entsprechenden Plattformen sind im Netz unschwer zu finden. Viele Buchhandlungen bieten daneben telefonische und E-Mail-Bestellungen an und haben Lieferdienste eingerichtet.
Schwäbischen Geldbeuteln, die sich nur schwer öffnen, sei an dieser Stelle verraten: Das Buch ist in den Stadtbibliotheken Ulm und Neu-Ulm vorhanden und kann dort unter Beachtung der geltenden Regularien entliehen werden.
Haag, Jan; Köhler, Bernd Michael: “Seien Sie gegrüßt liebe Freunde in Ulm”. Hermann Hesse und die schwäbische Donaustadt. Klemm+Oelschläger, 2018. Gebunden, 114 Seiten, Euro 12,80 ISBN 978-3-86281-132-8
***
Eine Besprechung des Buches in der Ulmer Südwest Presse ist hier zu finden.
***
Hfier einige kurze Einblicke in den Text des Buches:
In seinem selbstironischen Reisebericht Die Nürnberger Reise berichtet Hermann Hesse von einer Lesung in Ulm im Jahr 1925. Haag/Köhler schildern wie es danach weiter ging:
“Nach der Lesung saß man bei der Familie von Lydie und Eugen Link in der Neutorstraße 7 mit dem Museumsleiter und einigen wenigen anderen beim Wein zusammen. Gut vorstellbar, dass noch ein Eugen dabei war. Eugen Zeller, der zudem ganz in der Nähe, in der Bessererstraße 9, wohnte. Eine solche vertraute und überschaubare Runde hatte Hesse frühzeitig in der für ihn typischen Weise eingefordert, wie einem Brief an Eugen Link vom 18. Oktober 1925 zu entnehmen ist: Den auftauchenden Vorschlag zu einem Bankett oder einem Zusammensitzen eines größeren Kreises nach dem Vortrag bitte ich unbedingt abzulehnen. Sonst riskieren Sie, daß Sie mich morgen in Ihrem Gastzimmer erhängt finden.”
Vier Jahre später las der eigenwillige Hesse wieder in Ulm:
“Nach der Lesung 1925 im Museum mit seinem verhältnismäßig kleinen Veranstaltungsraum war der Wunsch entstanden, den Dichter erneut in Ulm zu erleben. Diesmal hatte man den deutlich größeren Saal angemietet, um den zu erwartenden Ansturm zu bewältigen. Dennoch musste erneut eine erhebliche Zahl Interessierter wieder nach Hause geschickt werden. Der übervolle Saal wurde als ein sprechender Beweis für das aufsteigende, kulturelle Interesse der Ulmer interpretiert. Auch Jacques Offenbachs Schöne Helena, die zur gleichen Zeit im städtischen Theater ihre Reize spielen ließ, konnte den Ansturm auf die Vorlesung literarischer Werke nicht mindern.”
Über Hesses eigene literarische Vorlieben ist unter anderem zu erfahren:
“Was Hermann Hesse und Eugen Zeller teilten, war ihre Leidenschaft für den Landsmann, unfreiwilligen Landpfarrer und Dichter aus Berufung, Eduard Mörike (1804 – 1875). Der Ulmer Lehrer (Zeller, J. H.) sammelte Bücher und Gegenstände aus dessen Nachlass. Hesse war sehr an diesen Devotionalien interessiert und wandte sich mit einer entsprechenden Bitte an den Freund. Ihrem Wunsche ein Mörike-Original zu besitzen, bin ich gerne zur Verfügung, war die Antwort. … Doch von den eigenen Schätzen gedachte er nichts abzugeben. Zeller vermittelte den Kontakt zu Fanny, der zweiten Tochter Mörikes, die zeitweise mit ihrem Mann in Neu-Ulm … “



![neckar-7[1]](https://litos.files.wordpress.com/2009/11/neckar-711.jpg)